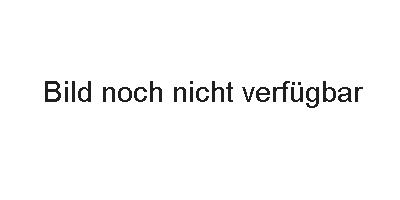|
Horridonia horrida SOWERBY 1822 Horridonia horrida ist der größte Brachiopode im Zechstein. Den im Wortsinne „schrecklichen“ Namen verdankt er seiner bedrohlich wirkenden Bestachelung (siehe Abb. 3).
wie es für die „Frischwasserriffe“ am Rand des westlichen Thüringer Waldes typisch ist. Der Schloßrand (nur leicht beschädigt) ist 9cm lang. Horridonia horrida ist neben der Bryozoe „Fenestella“ retiformis das bekannteste Leitfossil des „Unteren Zechstein“. Dieses auffällige Fossil wurde schon in der vorwissenschaftlichen Epoche beschrieben. Die wohl älteste Erwähnung findet man bei C.T. HOPPE (1745) der ihn als „Gryphit von Gera“ führt. SCHLOTHEIM (1813) führt ihn als Gryphites aculeatus. Und schreibt, daß diese Art im Zechstein, besonders im „Gryphitenkalk“ (gemeint ist wohl die Productusbank) massenhaft vorkommt, außerdem bildete SCHLOTHEIM (1813) Funde aus dem oberen Kupferschiefer („bituminöser Mergelschiefer“) von Schmerbach ab. (vgl. Abb.3) Eingehender beschrieben wurde dieser Brachiopode aus dem englischen Zechstein durch J. de SOWERBY (1822). Er bekam den Namen Productus horridus. Später erkannte man aber, daß sich hinter dem Gattungsnamen Productus eine ganze Gruppe (im Sinne einer Unterordnung bzw. Oberfamilie) verbirgt, die vom Unteren Devon (ca. 408 Ma) bis zum Ende des Perm (ca. 251Ma) existierte. Diese formenreiche Gruppe musste zwangsläufig in eine Vielzahl von Gattungen aufgesplittert werden. „Productus“ horridus wurde zur Gattung Horridonia (CHAO 1940) gestellt. JORDAN (1968) sieht in Horridonia nur eine Untergattung von Productus. Der Name „Productus“ ist im Zechstein bis heute sehr geläufig, ist aber eher ein Sammelbegriff als ein Gattungsname.
Fundort: Altensteiner Höhle bei Schweina. Obwohl die Productiden an der Perm/Trias-Grenze vor ca. 251 Ma ausstarben und es keine vergleichbaren noch lebenden Verwandten gibt, ist die Lebensweise dieser Tiere recht gut bekannt. Man kann sie aus der Schalenform ableiten: Die Dorsalklappe („Stielklappe“) ist stark konvex gewölbt, und trägt meist Stachel. Die
Ventralklappe („Armklappe“) ist mehr oder weniger stark konkav und unbestachelt. Der gerade Schloßrand ist i.d.R. die breiteste Stelle des Gehäuses und mit einer Reihe langer Stachel versehen.
Bei diesem „in situ“ - Fund sind die langen Stachel noch erhalten. Sammlung R. Sandmann (Eisenach) Die Stachel dienten der Verankerung im weichen Sediment und verhinderten ein Einsinken. Bei den meisten Fundstücken sind die Stachel abgebrochen, ein Hinweis darauf, daß der abgestorbene Brachiopode vor seiner entgültigen Einbettung umgelagert wurde. Sind die Stachel noch dran, wurde der Brachiopode an seinem Lebensort eingebettet. Ist also autochton. Die „gewölbt unten“ Position, die der Lebendposition entspricht, ist für sich genommen kein sicherer Hinweis auf Autochtonie. Auch umgelagerte (allochtone) Exemplare bleiben oft in dieser Stellung liegen, ihnen fehlen aber die Stachel. In den Riffen findet man Horridonia häufig autochton, aber es ist beinahe unmöglich, ein Exemplar aus dem harten Kalk so zu bergen, daß die langen fragilen Stachel nicht abbrechen (was bereits SCHLOTHEIM 1813 erwähnt).
Die äußeren Merkmale von Horridonia sind sehr variabel und hängen vom Standort ab. JORDAN (1968) untersuchte wie vor ihm bereits EISEL (1909) die Productiden-Fauna des Zechsteinkalkes in der Geraer Bucht und bestätigt die Beobachtungen EISEL’s, wonach es in diesem Gebiet 6 „Variationen“ gibt. JORDAN sieht in ihnen Unterarten von Productus (Horridonia) horrida und erkennt in den Geraer Profilen eine phylogenetische Reihe: Die Exemplare in den tieferen Schichten sind kleiner, haben einen kurzen Schloßrand und keine Stacheln auf der Schale. JORDAN (1968) sieht in der zunehmenden Größe und Bestachelung, einen evolutionären Trend. Eine Ansicht die heute allgemein abgelehnt wird. Man geht davon aus, daß die Wuchsformen ökologisch bedingt sind. Demzufolge sind die verschiedenen Productiden-Varianten im Zechsteinkalk keine Leitfossilien sondern Faziesanzeiger. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wie alle Kategorien ist auch die vom „Leitfossil“ nur eine von Menschen gemachte Schublade. Regional (z.B. innerhalb der Geraer Bucht) kann man auch Faziestypen zur Korrelation der einzelnen Schichtglieder in unterschiedlichen Aufschlüssen heranziehen, nur für eine überregionale Korrelation taugen sie nicht. Das es einen einfachen Zusammenhang zwischen der sedimentären Fazies und den darin vorkommenden „Productus“-Varianten gibt, wurde schon von MALZAHN (1937) nachgewiesen: In kalkarmen Mergeln ist Horridonia viel kleiner als in Gesteinen mit hohem Kalkgehalt. Besonders große Exemplare kann man in den Riffkalken (hochreinen Kalken) finden. Die größten einigermaßen vollständig geborgenen Exemplare aus den Thaler und Liebensteiner Riffen haben eine Schloßrandbreite von 9-10cm. Möglicherweise gab es noch größere Individuen, einige Bruchstücke lassen das vermuten. Die Bergung vollständiger Exemplare ist jedoch sehr schwierig, da die Fossilien i.d.R. hohl sind, und die dicke Schale sehr brüchig ist. Die Abb. 1 zeigt einen Glückstreffer, bei dem lediglich die Stachel verloren gingen.
Literatur
|